Plötzliche heftige Schmerzen im Oberbauch können auf eine akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) hindeuten. Welche Ursachen gibt es? Wie sieht die Behandlung aus? Das Portal Gesundheitsinformation.de liefert einen wissenschaftlich fundierten Überblick.
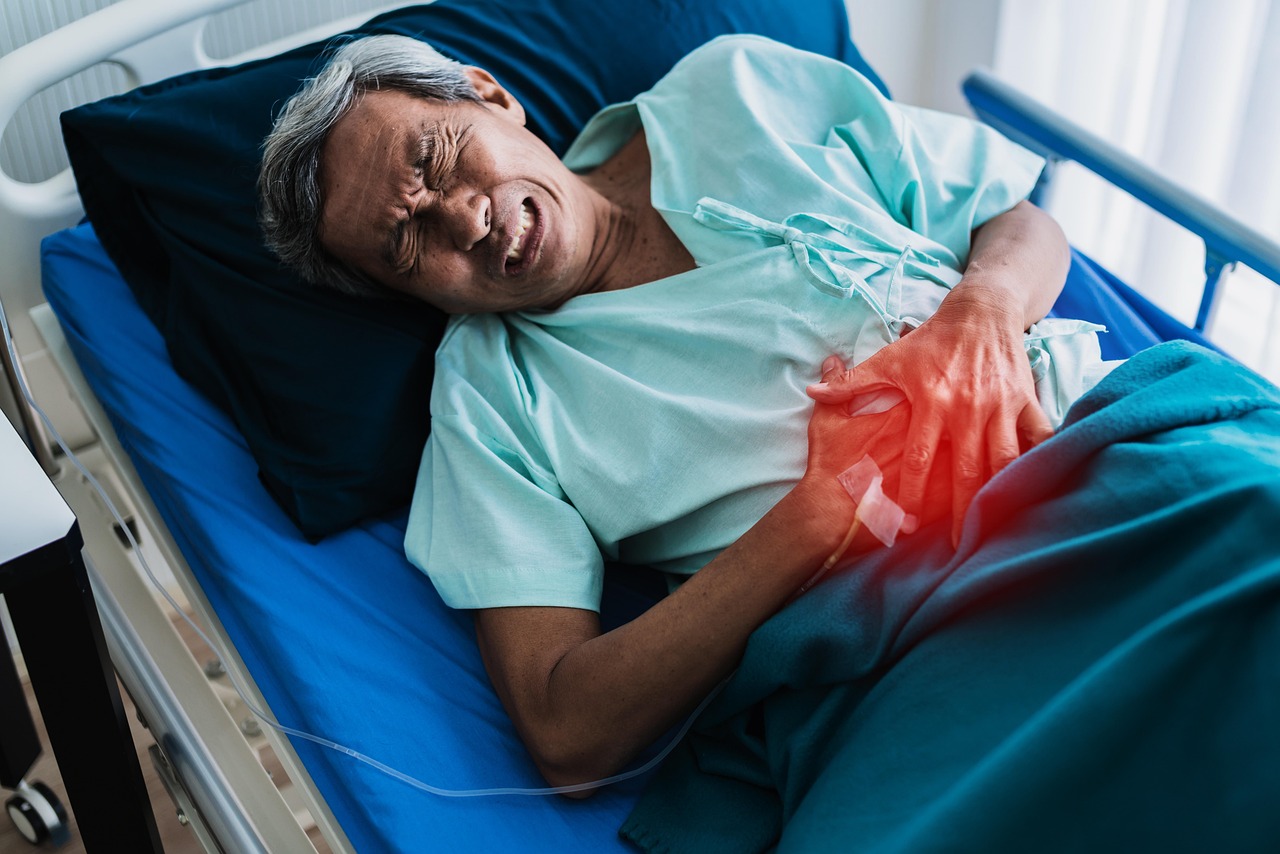
Das Online-Gesundheitsportal Gesundheitsinformation.de liefert ein breites medizinisches Themenspektrum für erkrankte sowie gesunde Bürger:innen. Krankheiten und medizinische Beschwerden werden ausführlich beschrieben, zusätzlich wird über Behandlungsmöglichkeiten informiert. Das Online-Gesundheitsportal stellt seine Inhalte Südtirols Institut für Allgemeinmedizin und Public Health zur Verfügung.
Bauchschmerzen sind unangenehm, treten aber im Alltag immer mal wieder auf – etwa, weil man etwas Falsches gegessen oder sich einen Magen-Darm-Virus eingefangen hat. Dann gehen sie in der Regel schnell wieder vorbei und sind nicht allzu stark.
Manchmal werden Bauchschmerzen aber auch durch eine ersthafte Erkrankung verursacht. Eine akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) macht sich durch plötzliche, sehr starke Schmerzen im Oberbauch bemerkbar. Die häufigsten Ursachen sind Gallensteine und ein zu starker Alkoholkonsum.
Meist ist die akute Entzündung nach einer Woche überstanden. Sie kann aber auch zu Komplikationen und Folgeerkrankungen führen. Dann kann die Behandlung mehrere Monate dauern.
Eine Pankreatitis wird im Krankenhaus behandelt, weil sie bei einem schweren Verlauf lebensbedrohlich werden kann.
Symptome
Fast immer führt eine akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse zu heftigen Schmerzen im Oberbauch. Sie können auch in den Rücken ausstrahlen und werden meistens von Übelkeit und Erbrechen begleitet. Oft kommt es zu Fieber, Kreislaufproblemen und einem aufgeblähten Bauch.
Die Schmerzen treten plötzlich auf und sind so stark, dass die meisten Betroffenen sofort sofort zur Ärztin oder zum Arzt gehen. In der Regel werden sie noch am gleichen Tag in ein Krankenhaus überwiesen.
Ursachen und Risikofaktoren
Die häufigste Ursache einer akuten Pankreatitis sind Gallensteine. Die Bauchspeicheldrüse produziert einen Verdauungssaft, der durch den Pankreasgang in den Zwölffingerdarm fließt. Dieser Gang vereinigt sich kurz vor dem Darm mit dem Gallengang. Wenn sich Gallensteine bilden und in den Gallengang wandern, können sie die gemeinsame Mündung verstopfen. Die Galle und der Pankreassaft werden dann gestaut. Dieser Rückstau führt wahrscheinlich dazu, dass sich die Bauchspeicheldrüse entzündet.
Normalerweise entfaltet der Verdauungssaft seine Wirkung erst im Dünndarm. Bei einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse wird er aber schon in der Bauchspeicheldrüse aktiv. Dies führt dazu, dass sich die Drüse „selbst verdaut“.
Die zweithäufigste Ursache für eine Pankreatitis ist starker Alkoholkonsum. Wie Alkohol eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse auslöst, ist noch nicht genau geklärt – der Zusammenhang ist aber in vielen Studien beobachtet worden.
Andere Faktoren, die eine Pankreatitis wahrscheinlicher machen, sind Verengungen im Gallengang sowie erhöhte Werte bestimmter Fette (Triglyceride) oder von Kalzium im Blut. Manchmal wird eine akute Pankreatitis auch durch Arzneimittel oder eine Virusinfektion ausgelöst. Operationen der Gallenblase oder der Gallengänge können ebenfalls zu einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse führen – dies ist aber sehr selten.
Bei bis zu 10 von 100 Menschen mit Pankreatitis lässt sich keine eindeutige Ursache feststellen.
Verlauf
Je nachdem, wie stark die Entzündung ist und wie sehr sie das Drüsengewebe schädigt, kann die Erkrankung unterschiedlich verlaufen. Etwa 80 % der Menschen, die wegen einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse behandelt werden, haben sie nach etwa einer Woche überstanden. Bei ungefähr 20 % treten ernsthafte Folgen auf – es kann zum Beispiel ein Teil der Bauchspeicheldrüse absterben und sich mit Bakterien infizieren. Wenn es dazu kommt, kann es Wochen oder Monate dauern, bis man wieder gesund ist.
Einige Menschen haben auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus noch Schmerzen oder Verdauungsprobleme oder fühlen sich sehr erschöpft. Die Genesung dauert manchmal lange, und es kann Rückschritte geben. Bis der gewohnte Alltag wieder möglich ist, braucht es häufig etwas Zeit.
Bei einer durch Gallensteine verursachten Pankreatitis kommt es oft zu einem Rückfall. Zur Vorbeugung wird dann empfohlen, die Gallenblase zu entfernen.
Folgen
Eine häufige Folge einer akuten Pankreatitis sind sogenannte Pseudozysten. Das sind mit Verdauungssaft gefüllte Blasen, die sich einige Wochen nach der Entzündung in der Bauchspeicheldrüse bilden können. Oft bleiben sie klein und unbemerkt, manchmal werden sie aber so groß, dass sie Beschwerden wie Magenverstimmung oder Völlegefühl verursachen. Bei größeren Pseudozysten besteht außerdem das Risiko, dass sie reißen und bluten oder eine Infektion auslösen.
Eine seltene, aber schwere Komplikation ist die sogenannte nekrotisierende infektiöse Pankreatitis. Dabei stirbt ein Teil der Bauchspeicheldrüse ab („nekrotisiert“) und infiziert sich mit Bakterien. Diese Komplikation tritt meist in der 2. oder 3. Woche nach Erkrankungsbeginn auf und ist sehr bedrohlich, weil sie zu einem sogenannten systemischen inflammatorischen Response-Syndrom (SIRS) führen kann. Hierbei breitet sich die Entzündung von der Bauchspeicheldrüse auf den ganzen Körper aus. Erste Warnzeichen können hohes Fieber, aber auch eine zu niedrige Körpertemperatur, Blutdruckabfall sowie ein erhöhter Puls und schnelle Atmung sein. Das Syndrom kann dazu führen, dass eines oder mehrere Organe versagen.
Insgesamt sterben etwa 3 bis 5 % der Menschen, die an akuter Pankreatitis erkranken, an Komplikationen.

Diagnose
Beim Verdacht auf eine akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse tastet die Ärztin oder der Arzt zunächst den Bauch ab. Sie oder er fragt zudem nach Risikofaktoren wie Alkoholkonsum, der Einnahme von Medikamenten und Hinweisen auf Gallensteine, wie krampfartige Oberbauchschmerzen (Koliken). In der Regel entnimmt die Ärztin oder der Arzt auch Blut und macht einen Ultraschall. Wenn sich der Verdacht auf eine akute Pankreatitis bestätigt, wird man ins Krankenhaus überwiesen. Eine entzündete Gallenblase, ein Herzinfarkt oder ein Magendurchbruch infolge eines Geschwürs können ähnliche Beschwerden verursachen wie eine Pankreatitis.
In der Blutprobe wird unter anderem der Gehalt von Lipase bestimmt. Dies ist ein Enzym, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und normalerweise in den Darm gelangt. Wenn sich deutlich mehr Lipase im Blut befindet als normal, deutet das auf eine Pankreatitis hin. Andere Blutwerte können auf einen Gallenstau hinweisen.
Meistens lässt sich bereits durch eine Ultraschalluntersuchung des Bauches erkennen, ob Gallensteine die Ursache sind oder die Bauchspeicheldrüse durch die Entzündung verändert ist.
Manchmal sind weitere Untersuchungen nötig. So können Gallengänge und Gallensteine auch mit einer Magnetresonanz-Tomografie (MRT) dargestellt werden. Oder es wird ein Endoskop durch die Speiseröhre bis in den Zwölffingerdarm eingeführt (endoskopischer Ultraschall). Dies kann zum Beispiel helfen, Steine im Gallengang zu finden.
Eine Computer-Tomografie wird gemacht, um Komplikationen wie das Absterben von Gewebe zu erkennen und den Verlauf zu beurteilen. Bei einer Pankreatitis, die durch Gallensteine ausgelöst wird oder mit einer Entzündung des Gallengangs einhergeht, kann zur Diagnose auch eine endoskopisch-retrograde Cholangiografie (ERC) erforderlich sein. Dabei wird ebenfalls ein Endoskop über die Speiseröhre bis zur Mündung des Gallengangs in den Zwölffingerdarm vorgeschoben. Dann wird ein Kontrastmittel in den Gang gespritzt, das vorhandene Steine auf dem Röntgenbild sichtbar macht. Im Rahmen der Untersuchung können die Steine mithilfe des Endoskops direkt entfernt werden. Die ERC geht aber mit einer Strahlenbelastung einher und kann zu verschiedenen Komplikationen wie Blutungen oder Infektionen führen.
Behandlung
Es gibt keine ursächliche Behandlung gegen Pankreatitis – aber verschiedene Möglichkeiten, die Bauchspeicheldrüse zu entlasten und die Beschwerden zu lindern. Da eine akute Pankreatitis zu einem Flüssigkeitsmangel führen kann, wird zunächst über einen Tropf Flüssigkeit zugeführt. Beschwerden wie Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen lassen sich durch Medikamente lindern. Oft sind starke Schmerzmittel (Opioide) nötig, die schläfrig oder benommen machen können.
Damit sich die Bauchspeicheldrüse erholen kann, wird auf feste Nahrung verzichtet, bis es einem besser geht und man wieder Appetit hat. Bei einer leichten Pankreatitis ist es oft schon nach zwei Tagen wieder möglich, etwas zu essen. Bei länger andauernden Beschwerden kann eine künstliche Ernährung nötig werden, damit der Körper ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird.
Wenn die Pankreatitis durch Gallensteine verursacht wird, kann es sein, dass die Steine schnell durch eine Cholangiografie entfernt werden müssen. Nach der Akutbehandlung wird die Gallenblase dann später durch eine Operation entfernt, um Rückfälle zu verhindern.
Quellen
Boije K, Drocic A, Engström M et al. Patients’ Perceptions of Experiences of Recovering From Acute Pancreatitis: An Interview Study. Gastroenterol Nurs 2019; 42(3): 233-241.
Boxhoorn L, Voermans RP, Bouwense SA et al. Acute pancreatitis. Lancet 2020; 396(10252): 726-734.
Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM). S3-Leitlinie Klinische Ernährung bei Pankreaserkrankungen. AWMF-Registernr.: 073-025. 2024.
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Projekte und Ergebnisse. 2025.
Johnson CD, Besselink MG, Carter R. Acute pancreatitis. BMJ 2014; 349: g4859.
Moggia E, Koti R, Belgaumkar AP et al. Pharmacological interventions for acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev 2017; (4): CD011384.
National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Pancreatitis (NICE Guidelines; No. NG104). 2020.
Statistisches Bundesamt (Destatis). Eckdaten der Krankenhauspatientinnen und -patienten. 2023.
Wichtig zu wissen: Die einzelnen Artikel des Gesundheitsblogs des Instituts für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen werden nicht aktualisiert. Ihre Inhalte stützen sich auf Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Belege, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar sind. Gesundheitsinformationen aus dem Internet können eine persönliche ärztliche Beratung nicht ersetzen. Informieren Sie Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin über mögliche Beschwerden. Weiter…











